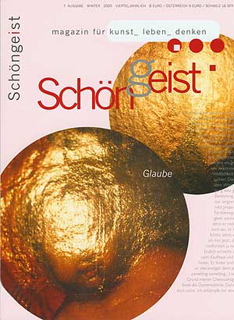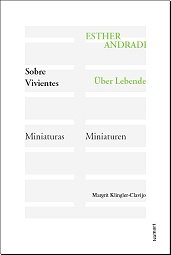Texte
Sonntag, 5. November 2006
Vera Schindler-Wunderlich
Alptraum
Jemand weiss, jemand schreibt,
wie: ein Konzept, gibt Gas, tritt in
Kraft, Berg voll Links, schwimmt
im, schwimmt sein Kopf im Sumpf,
halb Back, halb Werk. [Halb drei.]
Mach hell, mach hell. [Macht hell.]
Alles Bett, Bett. – Doch psst,
jemand rennt, jemand wühlt,
pflückt Zahl, ein Gebell, stich Wort,
Wissen her, wie. Wer kennt diese
Hand, diesen Link, diesen hint;
mein liebes, liebes Amt, mein
Papier; am Steuer das Konzept,
rast vor [halb vier], gibt Gas, grüsst
Zimmer fünf. – Wir sind für uns da,
ein Biss dieser Nacht. Mach hell,
bell auf, schreib ab [halb acht].
Es war acht
Es war acht: Wir zogen
Prozesse, wir begossen
den üblichen Morgen mit Tee,
wir fütterten den Vordergrund;
es war neun. Ich, eklig:
Ich bin ein Teilprojekt.
Ich bin ein reiner Antrag.
Ich bin ein häufiges Verfahren;
ich bin schon Revision.
Es war zwei, eins war klar:
Nichts war entschieden, doch:
Hinlänglich sollte man schon.
Was sind wir feige Fugen,
dachten wir bis fünf. Doch du:
Ich bin ein Teilprojekt;
ich bin ein kleiner Antrag.
Ich bin hinlänglich sicher:
Ich bin bereits erfolgt.
Es wurde acht: Wir flogen
Prozesse, wir kippten
Zeilen, wir schrieben uns ab.
Frage: Was wird eigentlich aus unseren
Stellen?
Antwort: Man fasst, befasst mit dieser Frage sich,
vielleicht gibts Fisch, vielleicht mit dieser
Frage. Da immerhin am Mittag, Teilprojekt,
man nimmt sich vor, so fest aufgrund von
gestern. Gelegentlich, von morgen her,
und hat sich vorgenommen, Fisch, doch
jetzt noch nicht, das spielt sich ein,
so fern am Tisch, entfällt der Abzug gern.
Erfolglich später, immer hin am Schluss.
Und endlich fasst, befasst sich, her damit.
Gelegentlich maßgeblich Dank, wir wissen,
schallt im All die Frage Frage, Teil des
Hirns Hirns, befasst mit dieser dieser
Frage:
Maiabend I
Weiß was, es ist Maiabend,
das liest sich an diesem Maiabend.
Die Berge schimmern so für sich,
die Stare schneien schwarz über
den Hinundher-Himmel.
Weiß was, es ist Bergfrieden, die Berge,
sie lesen sich so für sich.
Die Leute wären einschlägig, wären sie hier
an diesem weißen, zwitschernden Abend,
so endlich für sich.
Parlament
All das Heißen, das Gutheißen,
das Billigen: der Pärke, der Panzer,
der glänzenden Schienen,
der Mittel, der Saal
der endlosen Bienen, das ewige
Zimmern, dauernde Schaufeln.
Dies war der Tag,
der Tag der Schwämme, der Tag
des Tages, des sägenden Antrags.
Doch all das Heißen, der ganze Samt,
erhebliche Glanz, angebliche
Honig. Das Billigen der
Bienen, glänzende Zimmern,
der Panzer des Antrags, erhältlich
im Saal.
Wir sind, doch wir fallen noch
an, und wir sind auch
im Druck, erhältlich
im Saal.
Nicht wahr, Geld
Nicht wahr: Geld ist eben nicht Geld: Geld
kommt daher in tausend Formen: als Mozart-
Sonate, als guter Name, was man sich spart,
als virtuelle Obhut, News, quod libet. Geld bellt
als Muh, sprich Cashcow, als Kinderbelang,
als Vorkommnis jeglichster Art, als unbar, Judas’
Evangelium, als Tonne Teer, als tu du was
für dich, als schnatterndes Update, satter Abgang.
Hier sind sie, die Metamorphosen von Geld: als Fett
und dessen Abbau, Hamster dieser Welt, als Schecks,
als schneller casus belli, als virtuell verquaster Sex,
als Als-ob-Option, als Sakrileg, als Öl, als olet.
Wär Geld nicht Geld wär quid pro quo nicht wahr,
wär Muh kein Ablass, Schuld nicht updatebar.
(Inspiriert durch ein Votum des Schweizer Finanzministers aus der Ständeratsdebatte vom 14. März 2006.)
Vera Schindler-Wunderlich
gelesen am 22.9.2006
schoenfeldt - 5. Nov, 12:03
Dienstag, 16. Mai 2006

© Johannes Groschupf
Zu weit draußen
schoenfeldt - 16. Mai, 22:56
[...]
Die Weidenzweige habe ich in einer Gärtnerei am kleinen Wannsee gekauft. Sie haben in einer hohen Vase aus Plastik neben Sträußen von Tulpen in verschiedenen Farben gestanden, es waren normale Tulpen darunter, solche, wie sie schon immer ausgesehen haben, mit glattrandigen Blütenblättern in einfachen Farben, Farben aus dem Kindertuschkasten, rot, gelb, weiß, orange. Dazwischen haben sich Exemplare der neuen Züchtungen verneigt, extravagante Köpfe auf langen Hälsen, eine Art Papageienblumen in auslaufenden, sich miteinander vermengenden Farben, empfindlichen Tönen: Lachs, Scharlach, Violett. Die Weidenzweige haben kahl gestanden neben diesem hoch aufblickenden Meer aus Blumen der Kindheit – den einfachen Tulpen, mit ihren Häuptern gerade und wach sitzend auf robusten Stielen –, und den schwierigen langstieligen Tulpen, die an ihren äußersten Rändern zerfaserten, mit ihren Häuptern schwach und aufgerieben in dem Licht lagen, das die Vorfrühlingssonne an diesem Tag hinter einem dünnen grauen Wolkenschleier über den Himmel verstreut hat. Ich habe mit meinem Arm an dem Blumenwald vorbei zu den Weidenzweigen gelangt, es ist ein großer Arm voll gewesen, der in der Vase gestanden hat, und habe nach vier oder fünf davon gegriffen. Als ich sie im Arm gehabt habe, ist mir ihr Geruch von frischem angeschnittenem Holz in die Nase gestiegen, der Geruch von beginnendem oder gebrochenem Grün. Von den Enden der Zweige hinab ist mir Wasser über die Hände in die Ärmel meines Wollmantels gelaufen. Ich habe gezahlt und bin mit den Zweigen im Arm auf die Straße zurückgegangen, an deren Rändern Reste harschen Schnees gelegen haben.
[...]
Ich bin mit den Weidenzweigen die Straßen entlanggelaufen und habe hier und da mit den Füßen ein Stück Schnee zertreten, der nur noch ein kleines Überbleibsel, das Ende des langen kalten Winters gewesen ist. Ich habe ihn austreiben wollen wohl mit diesen Tritten, den Winter, es hat leise geknirscht unter den dicken Sohlen meiner Schuhe. Die Zweige haben vor meinem Gesicht gestanden zwischen mir und dem Winter und einen Scherenschnitt ergeben, wenn ich sie von meinem Gesicht fort an den Himmel gehalten habe. Es ist später Nachmittag gewesen, blaue Stunde in den letzten Tagen des Februar, der Himmel ist an seinen hinter dem Grunewald abtauchenden und dennoch durch ihn hervorscheinenden Säumen aufglimmend hell gewesen. Ich bin so mit dem dunkelnden Profil der Weidenzweige vor meiner Brust Schritt für Schritt, habe ich gedacht, aus dem Winter hinausgelaufen, die lange Straße hinunter zum See. Streukörnchen sind unter meine Schuhe geraten und ich bin, kurz vor den grauen Flachbauten am Ende der Straße, in die ich gehörte und wo ich mich vor einer Stunde abgemeldet hatte, eine winzige Strecke, eine Ameisenstrecke lang, auf den Kreppsohlen meiner Schuhe über den Asphalt gerollt.
[...]
Einer hat gesagt: also hat sich etwas verändert, das begrüßen wir stets. Er ist gekommen, weil ich der Schwester in ihre Tüchtigkeit hinein von den Krakenarmen gesprochen habe. Sie hat es nicht verstanden. Sie ist wiedergekommen, und hat mich aus dem Bett ziehen wollen wie ein Fischerboot aus den Wellen. Ich habe mit den Krakenarmen um mich geschlagen. Da hat sie ihn kommen lassen. Er hat eine Weile bei mir gesessen mit einer Tasse Tee, der Tee ist neben seinen Worten in der Tasse hin- und her geschaukelt.
Ein anderer hat gesagt: es handelt sich meist um die Liebe. Wie steht es damit. Ich habe wieder auf meine Krakenarme gezeigt, die sich nicht einrollen lassen wollten, und habe gesagt, es sei keine Liebe, sondern ein Rudern im All, sternenweise würde der Sinn verlöschen, ich hätte vergessen wie man das mache, aufstehen, und mit Verstand.
Nicht nur diese Gedanken sind dunkel gewesen, sondern hinter den Neonröhren im Flur der Klinik direkt hat es angefangen, dunkel zu glimmen. Das habe ich an einem anderen Tag dem Teetrinker erzählt, er hatte lange Beine, deren Knie vor seinem in einem Sessel versunkenen Körper steil aufragten, ich habe gesagt, es würde nicht aufhören, zu verlöschen und dunkel zu sein, dabei wüsste ich gut, ich hätte zu tun, das schiere Blicken brächte nichts ein, man müsse doch tüchtig sein. Er hat gefragt: auch in der Liebe?
[...]
In der Nacht, in der mich der Arzt hinter seinen Knien hervor gefragt hat, ob ich auch in der Liebe tüchtig wäre, habe ich in einer knappen Schlafphase von den Weidenzweigen geträumt. Sie waren nackt vom Winter und wuchsen am Ufer eines Flusses. Der Fluss war breit und dicht hinter einer weit in die Aue hineinziehenden Mäanderung gestaut. Das Bild des Staus ist sehr eindringlich gewesen, und ich bin aufgewacht. Mein Mund ist trocken gewesen und ich habe geschwitzt. In einer nächsten Traumphase habe ich den Fluss wieder gesehen, die Stauung des Wassers, und wie Holzscheite auf ihm geschwommen sind und sich an dem Damm gesammelt haben, die Miniatur eines auseinandergerissenen Bandes von gefloßtem Holz. Der Traum ist von dem nassen Holz wieder zu den trockenen Weiden am Ufer geschwenkt. Sie haben nichts weiter getan, als dort zu stehen, lockige, in den Himmel wachsende Arme.
[...]
Dass mich die Ärzte befragt und beobachtet und mir versprochen haben, es werde sich etwas ändern, wenigstens würde ich von einem Zustand zu einem anderen überwechseln, auch wenn sie nicht versprechen könnten, dass der eine sich besser als der andere anfühlen werde, dass ich diese Zuwendung bekommen habe, ist ein zwei Wochen gegangen, auch gerade deswegen, weil ich öfter bei ihnen vorgesprochen habe. Ich habe gedacht, sie könnten mir erklären, wieso es so sei, dass ich das Gefühl gehabt habe, meine Gedanken materialisierten sich, würden auf ganz unmittelbare Weise sich ihren Weg nicht nur durch meinen Kopf, sondern auch durch meinen Körper bahnen. Ich habe das kurz beschreiben sollen, aber wenn ich in die Details gegangen bin, haben sie mich nach meiner, wie sie sagten, ‘Lebenssituation’ zu fragen begonnen, die es doch gar nicht gegeben hat, das ist es ja gerade gewesen, die Materialisierung meiner Gedanken und Gefühle hatte dazu geführt, dass sich mein Platz in den Tagen, die vergangen waren, und innerhalb der Dinge, die ich getan hatte, weil ich dachte, man täte sie oder müsse sie tun, ausgehebelt hatte.
Das Material ist in mir sedimentiert in den zwei Wochen, in denen ich von diesen Gefühlen und von meinen Gedanken erzählt habe. Die Ärzte und eine unüberschaubare Belegschaft von Männern und Frauen in weißen Kitteln haben mich angeschaut, ein grauhäutiger Arzt, den ich nicht aus direkten Gesprächen kannte, hat dabei hinter einem rollbaren Pult gestanden, auf dem sich großformatige Karteikarten gestapelt haben. Er hat in eine der Karten geschaut, wenn ich gesprochen habe, ich weiß nicht, ob er mir zugehört hat, und dabei ist ihm immer wieder eine Tolle weißer Haare in die Augen gefallen. Er hat ein schweres Tweedjacket getragen, jeden Tag ein anderes, immer in einem etwas anders getönten Grau oder Braun. Er hat gerochen, nach Ungelebtem, das habe ich bis zu meinem Bett wahrnehmen können, und ich habe gedacht, vielleicht müsste ich ihn fragen, wie es ihm geht und ihm einmal den Strunk weißer Haare aus dem Gesicht streichen.
[...]
Dann haben sie mich gestraft. Je öfter ich das gleiche gesagt und gespürt habe, dass ich das gleiche gedacht habe immer noch, desto schneller sind sie mit ihrem geräderten Pult an mein Bett heran und wieder von ihm fort getreten. Dabei habe ich abends bereits auf ihr Herantreten an mich gewartet; jedesmal habe ich gehofft, sie könnten mir etwas Neues berichten, was das hätte sein können, darüber habe ich nicht nachgedacht, denn mir ist nichts mehr eingefallen.
[...]
Sie waren enttäuscht, das stand auf ihren Stirnen geschrieben. Der Arzt hinter dem Pult hat sich gar nicht mehr gemüht, seine Tolle nur für einen kurzen Blick auf das Fußende meines Bettes an den Rand seines Gesichtes zu schieben. Ich habe gespürt, wie ein Vorhang zwischen ihnen und mir gewachsen ist und ich habe mir in den Nächten Vorwürfe gemacht. Es sind damals zwei Wochen gewesen, in denen ich nicht geschlafen hatte außer weniger Augenblicke, in denen sich stets ein oder zwei Träume abgespult haben. Auch das Bett unter mir ist enttäuscht gewesen, dass ich nicht schlafen konnte, es hat sich in kurzen Intervallen unter mir bewegt. Ich habe auch davon erzählt, und einer der neben dem Pult stehenden Ärzte, es ist der Langbeinige gewesen, hat gesagt, das seien Sensationen, für die der Geist in der Phase des Hinübertretens in den Schlaf empfänglich sei. Das abzumildern wäre nur möglich, wenn ich einmal ordentlich schliefe, aber ich zeige mich ja generell unempfänglich für ihren Rat, sie würden dies zutiefst bedauern, für mich würden sie das bedauern.
[...]
Einige wenige Male ist die Traube von Ärzten und Schwestern noch an mich herangetreten, dann ist sie mich nur noch umgangen. Das ist auch die Zeit gewesen, in der auf dem grauen Tablett, das zum Mittagessen ins Zimmer gekommen ist, neben dem üblichen Essen und dem Geschirr und Besteck, eine Banane aufgetaucht ist. Ich habe die gelbe Frucht nicht richtig zu nehmen gewusst, aber sie kam jeden Tag. Sollte ich sie essen? Ich habe auf die Tabletts der anderen geschaut, ob sie auch eine Banane bekamen, aber ich war die einzige. Ich habe die Bananen schließlich in meinem Zimmer gehortet, und einen Haufen neben meinem Bett aus ihnen gebildet. Eines Tages ist der Blick einer der Schwestern darauf gefallen und sie ist mich angegangen. Ich habe erklären wollen, es seien doch meine Bananen und so könne ich doch mit ihnen machen, was ich wolle. Der Blick der Schwester hat sich verengt und hat sich tief in mich hineingeschraubt, dann hat sie gesagt, ich solle ihr nichts zu erklären versuchen, ich hätte schon zu viele eigene Gedanken. Sie hat ihren großen Leib an mir vorbei an das Kopfende des Bettes geschoben und nach den Früchten gelangt, die aufeinander lagen und einen süßlichen Duft in das Zimmer verströmt haben. Sie hat die Bananen eine um die andere vor ihrem Busen aufgebaut und gesagt, es gäbe andere auf der Station, die würden sich über die Früchte freuen. Damit hat sie die dünnen Mädchen gemeint, die sich in den Zimmern neben mir aufhielten, und sich mit einer ganzen Gruppe von Schwestern trafen, um mit ihnen den Tisch zu decken, das Besteck, eine Gabel und ein Messer für jede, für keine mehr oder weniger, zu verteilen und dann das Essen zu üben, unverzüglich und ohne Umschweife die Gabel an den Mund zu führen mit den Dingen darauf, die ihr Körper brauchte. Sie hatten nämlich ihre Körper mit zuviel versehen oder sie mit zu wenig bedacht, das mussten sie jetzt ausbügeln. In dem großen Gemeinschaftsraum am Ende des grauen Flures auf der linken Seite des Gebäudes, von meinem Zimmer aus gesehen, haben sie zusammen gesessen. Sie haben die Tür aufgelassen, um das Aushalten des Blickes von anderen auf ihr Essen zu üben. Eine Stille ist von ihrem Essen ausgegangen, in der sich mir der Magen umgedreht hat. Allein das Klirren des Bestecks ist zu hören gewesen, und es hat sich in dem langen Raum des Flures gebrochen, wenn ich darin auf- und abgelaufen bin.
Also sagte die Schwester, es gäbe da andere, die sich über die Früchte freuten, denen sie sie aber leider nicht zukommen lassen dürfte. Ich habe sie endlich gefragt, was die Früchte auf meinem Tablett überhaupt bedeuteten, da hat sie, mit dem angehäuften Bananen vor ihrer Brust, gezischt, man hätte festgestellt, ich hätte einen Mangel.
[...]
Wieso ich denn noch einen Mangel hätte, habe ich die Schwester gefragt, ich hätte doch bereits über Wochen diese Astronautenkost gekriegt. Die Schwester hat gemeint von nichts kommt nichts, nein, sie hat gesagt von nischts kommt nischts und hat ihren Körper durch die Tür aus dem Zimmer geschoben auf den Flur. Ich weiß nicht, ob die Bananen, die weiterhin auftauchten, und die ich nun unter dem Kopfende des Bettes gehortet habe, bis der süße Geruch alles durchdrungen und auf die Flure hinausgerochen hat, meinen Mangel behoben haben. Ich habe sie an einem Abend als einen gesamten Brei verschlungen. Ich habe auf der Terrasse meines Zimmers gesessen, den Kiefern gegenüber, habe die Stille gehört, die von dem Gebäude ausgegangen ist – seine Flure waren von Mädchen und anderen vormals darin Wandelnden leer –, habe auf diesem Archipel aus Waschbeton weit hinaus in den Abend geragt und habe die Bananen in ihrem Brei mit einem Mal allesamt aufgegessen.
[...]
[...] Trotzdem habe ich in diesen Tagen angefangen, Holz zu sein.
[...] Zwei letzte Tage hat es gegeben. An dem einen ist die Schwester mit dem heiligen Namen zu mir gekommen, und in seiner späteren Hälfte bin ich zum kleinen Wannsee gelaufen. Ich habe das Hinausgehen ja gekonnt. Als Holz habe ich mich gut zu den Bäumen stellen können. Später bin ich auf die Gärtnerei gestoßen. Wieder habe ich mich erinnert: was schön gewesen ist. Gärtnereien, Lüfte, wenn sie kalt waren. Ich habe meine langsamen Augen über die Kübel und Vasen streifen lassen, die auf dem kleinen Gelände der Gärtnerei herum gestanden haben. Hyazinthen, gedrungene Armfüllen von dem violettstichigen Blau, daneben die selben Füllen in Weiß. Und dann sind da die Tulpen gewesen. Die mit den glattrandigen Blütenblättern in den einfachen Farben und die Langhalsigen, zusammen ein mich anblickendes Blumenmeer in verschleiertem Sonnenlicht.
Die Weidenzweige habe ich dicht hinter den Tulpen stehen sehen, sie haben vor dem weißlackierten Glasrahmen der Eingangstür der Gärtnerei in einer hohen Vase gestanden. Ich habe nach ihnen gegriffen, das ist wieder ein langer Weg gewesen. Mit den nassen Ärmeln meines Wollmantels bin ich in die Gärtnerei getreten, es ist dort fast genauso kühl wie draußen gewesen, und hat aber nach Frühjahr gerochen. Ich habe einer Frau den Betrag für die Zweige gegeben und habe die Gärtnerei verlassen. Die Zweige habe ich vor meinem Gesicht gehabt auf der leeren Straße, sie sind eine letzte oder erste Idee gewesen, sie sind aus dem Traum gekommen.
© Rike Bolte
gelesen am 12.05.2006
schoenfeldt - 16. Mai, 22:30
Nie ist das anders gewesen. Ihm fällt nicht ein, wann es ge-wesen sein sollte, das letzte Mal anders, oder wo. Immer wie-der läuft alles in seinem Leben auf einen Zusammenprall hin-aus, die Dinge oder Menschen, die zu sehr in seine Nähe ge-raten, scheinen sich ihm unweigerlich in den Weg zu stellen, irgendwann, und manchmal vermutet er hinterher, sie seien allein zu diesem Zweck in sein Leben getreten, er sollte an-ecken an ihnen, vielleicht ist es sein Schicksal, anzuecken, immerfort.
Dafür allerdings sieht er noch ganz gut aus, findet er heute, er schaut in den Spiegel, legt sein Morgengesicht frei unter dem Rasierschaum und ertappt sich dabei, ein wenig stolz zu sein auf sein kantiges Kinn. "Du bist so männlich" hatte die Frau in seinem Bett ihm vorher noch ins Ohr gewispert, das war gewesen kurz bevor er sie dann hinausgeworfen hatte, gänzlich.
Wo doch der Mensch an sich ein Weicher ist, äußerlich weich fast am ganzen Körper, wenn man einmal von Kinn und Ellenbogen absieht, die Knie auch noch hart, ja, fürs Beten in der Kirche, Erlösung muss weh tun, das hatte er als Ministrant gelernt. Für einen Moment sieht er sein Kindergesicht im Badezimmerspiegel.
Er lächelt sich an, versucht, sein unschuldiges Kinderlachen noch einmal abzurufen, doch seine Anstrengung lacht mit, die ganze, im Lauf der Zeit aufgebrachte Anstrengung, die nötig gewesen war, um sich nach jedem Zusammenprall wieder aufs Neue herzustellen, dabei innerlich weich durch und durch, das Harte nur Hornhaut, weich war auch die früher einmal gewesen, erst neulich wieder war er einer anderen, gleich ihm rein äußerlichen Verhärtung in Person begegnet, ein alter Schulfreund, einer der ganz wilden Kerle damals, lange Haare, Lederjacke, und geadelt diese Ungezähmtheit vom geklauten Mercedesstern, vor die Brust gehängt wie eine Trophäe von der letzten Großwildjagd, und jetzt, wie wesensverwandelt, so ganz der Businessman, im mausgrauen Anzug, der ehemals Ungezähmte eine einzige Bügelfalte, die reicht ihm nun bis zwischen die Augen hinauf, nicht ungewöhnlich so ein Werdegang, das weiß er selbst nur zu gut, man lernt nie aus, überlebt so einiges, das Fell wird dicker, und sein Großvater wusste das auch schon zu berichten, was einen nicht umbringt, härtet ab.
Aber da ist dieser Händedruck gewesen, der Händedruck seines Schulfreunds aus noch ungezähmten Tagen, und Druck ist hier der völlig falsche Begriff, sie hatten sich schon, wie Männer es tun, die Hände gereicht zur Begrüßung, doch all das geschäftlich Auftrumpfende, dieses Geschliffene, Gelackte und Polierte des Schulfreunds verriet sich selbst als null und nichtig, in diesem Händedruck, der keiner war, noch selten hatte er etwas derart Weiches zur Begrüßung geschüttelt, zwei Sekunden nur reichten, um die ganze Nachgiebigkeit seines Schulfreunds erneut zu begreifen.
Der hatte sich auch nur getarnt, um die Geldströme nicht an sich vorbei fließen zu sehen, und unter der Tarnung hatte sich das Weiche in ihm erhalten, anscheinend, ein kleiner Rest von Weichheit war sogar sichtbar geblieben, im Vollbart seines Schulfreunds, den der sich hatte stehen lassen, damals wie heute, das fällt ihm jetzt erst, im Nachhinein auf, während er die letzten Bartstoppeln aus seinem Gesicht entfernt, vor sei-nem Badezimmerspiegel.
Genau dieser Vollbart war es gewesen, über ihm, jetzt fällt es ihm plötzlich wieder ein, er hatte nur noch den Vollbart seines Schulfreunds gesehen damals, nachdem er zu Boden gegangen war. Zuvor ein harter Faustschlag auf die linke Au-genbraue, und dann färbte sich das Bild rot.
Wie konnte dieser langhaarige Teddybär es wagen, sich über ihn lustig zu machen, mit schlappen 19 Jahren, die Welt bis dahin nur aus der Schulbankperspektive gesehen, aber den Marx auswendig zitieren können, noch nie einen Pfennig selbst verdient, aber es dann wagen, ihn, den langjährigen Banknachbarn, als angepassten Schnösel hinzustellen, für sein Elternhaus konnte man schließlich nichts, Geld war da nie Thema gewesen, es war da und wollte ausgegeben werden, und wie oft hatte er die ganze Clique ausgehalten, Runden spendiert, geizig war er nie gewesen, und dann hatte der Schulfreund ein Bier zuviel intus und ihn als verweichlichtes Muttersöhnchen hingestellt, mitten in der Diskothek, all die Mädels drum herum, "wo bei anderen das Rückgrat ist, haben sie dir Geldscheine reingeschoben, zum Arsch kucken sie dir schon raus," damit war der herzensweiche Schulfreund zu weit gegangen, das haben ihm die anderen hinterher bestätigt, und er hatte zurück gebrüllt, "geh doch nach Kuba, wenn du mit anderer Leute Geld Probleme hast, zieh rote Socken an und friss jeden Tag Reis mit Scheiß," Ende des Gesprächs, der Faustschlag saß, da hatte sich die ganze Weichheit für den Bruchteil einer Sekunde zusammengeballt, die Narbe ist immer noch zu sehen.
Sanft fährt er sie mit dem Zeigefinger entlang, ganze drei Zentimeter zum Zeichen seines aneckenden Lebensstils, der ihm anzuhaften scheint, oder ist es gar nicht er, sondern immer nur sein Geld, das die anderen als rotes Tuch und Kampfansage ständig missverstehen.
Er hat die Narbe nie als hässlich empfunden, sie lässt ihn verwegener aussehen. Wie er diesen Schulfreund gehasst hatte plötzlich, abgrundtief. Seitdem müssen alle Vollbartträger, mit denen er geschäftlich zu tun hat, ihre Fachkompetenz doppelt unter Beweis stellen, die Bereitschaft zum Zusammenprall ist ihnen ja schon ins Gesicht gewachsen, Schnauzbärte haben es da etwas leichter bei ihm, und die Glattrasierten, die Smarten sowieso, die hatten es ihm schon immer angetan, insofern hatte der Schulfreund damals nicht völlig falsch gelegen, und ja, er hält sich jetzt für liberal, ihm fällt kein Grund ein, warum er sich deshalb schämen müsste, liberal zu sein heißt letztlich doch nichts anderes, als Schluss machen zu wollen mit diesem permanenten Anecken überall, und wenn man die Ellenbogen schon nicht aus der Welt schaffen kann, sollte doch zumindest jeder die Chance kriegen, sie auch vernünftig zum Einsatz bringen zu können, jeder, auch sein Schulfreund schien es ja geschafft zu haben, trotz seines verräterischen Händedrucks.
Das schießt ihm durch den Kopf, während er sein Gesicht mit Aftershave benetzt, und unwillkürlich fährt er sich jetzt über seine Ellbogen. Er fragt sich, ob er das jemals zuvor schon getan hat, und dann cremt er sie ein, mit seiner extra fetthaltigen Handcreme, und von irgendwoher drängt sich ihm da das Bild seines Großraumbüros auf, in welchem er schon in einer Stunde sitzen wird, und alle Kollegen, er eingeschlossen, sind splitternackt, die Körper glänzen wie Speckschwarten in der Sonne, eingeölt von Kopf bis Fuß mit Gleitfett, kein Rempeln mehr und Anecken, nur noch ein freundliches Glit-schen in der Luft, wenn zwei sich versehentlich oder auch in voller Absicht zu nahe kommen, diese Idee gefällt ihm, be-schwingt ihn beinahe, während er immer noch gedankenverlo-ren seine Ellenbogen massiert, bedauerlich nur, findet er, dass das Leben nie so freundlich glitschig werden würde aufgrund eines unglücklichen Fehlers im System.
© Anja Koemstedt
gelesen am 12.05.2006
schoenfeldt - 16. Mai, 22:21
Dienstag, 21. Februar 2006
Wir saßen so gemütlich zusammen, bei Bier, Wein, Oliven und Schafskäse. Manche hatten Tsatsiki bestellt, alle kauten Brot. Hans trank Retsina. Er mag ihn einfach. Ich trinke Retsina eigentlich nur im Urlaub. Aus den Kneipenlautsprechern klang „Sitting At The Dock Of The Bay“.
Die Wand im Hintergrund, vor der wir üblicherweise sitzen, war bemalt mit der Dar¬stellung einer der Geburtsstätten des Rembetiko, des griechischen Tango. Viele nennen ihn auch den griechischen Blues. Hier spielen sie oft Rembetiko. Aus irgend¬einem Grund dachte ich an den Regisseur Costa-Gavras und an einen Film, in dem sie einem Jungen Stromstöße durch Zähne und Augen jagen. Das ganze ge¬schieht in einem Hörsaal für Offiziersanwärter. Einer von ihnen muss kotzen, rennt raus.
Was seine Kameraden mit dem wohl gemacht haben? Die Musik ist schön, ich be¬stelle noch einen Ouzo. Ich liebe unsere Mittwochsrunden.
Hans erzählt von seiner Kindheit in einer Militärdiktatur. Wir hören nur halb hin.
Viel¬leicht noch was Süßes? Nein, lieber noch ein paar Oliven mit Schafskäse. Und noch zwei Kristall, zwei Nord¬häuser, drei Ouzo. Hans bestellt noch einen Retsina. Ich trinke Retsina eigentlich nur im Urlaub. Ist doch interessant, dass manche Getränke, Gerichte und meistens auch Urlaubsbekanntschaften nur im Urlaub reizvoll sind, sich nicht in den Alltag integrie¬ren lassen.
Was ist denn das für ein Geräusch, das da immer wieder mal zu hören ist? Klingt wie ein Tier. Als ich mich umdrehe, um noch ein Bier zu bestellen, fällt mein Blick zufällig auf den Fernsehapparat in meinem Rücken. Ich setze mich, wann immer es möglich ist, so, dass ich den Fernseher nicht im Blickwinkel habe. Ich muss ihn sonst immer anstarren, und das ist wenig kommunikativ. Gerade läuft ein Gangsta-Rap. Der Ton ist ausgestellt. Irgendein Junge, der die Welt durch Beleidigungen herausfordert und ein paar frauenfeindliche Sprüche absondert. Kann ich mir schon denken.
„Am ätzendsten ist ja die ganze Frauenfeindlichkeit hier in dieser Männergesell¬schaft“, lässt Kati mal richtig Dampf ab. Kati muss es wissen: Sie versucht schon seit drei Jahren, einen Macker an Land zu ziehen. Ich proste ihr zu, sie ignoriert mich.
„In der Oper Tosca“, doziert Werner, „gibt es eine Szene, in der ein Typ eine Frau ins Bett bekommen will und sie deshalb zum Essen einlädt. Er ist ein absoluter Genießer und Kenner. Der Haken dabei“ – Werner piekst ein Stück Käse auf und stochert dann genussvoll zwischen den Zähnen – „also für die Frau und für ihren Lover, nicht für den Typen, also der Haken ist, dass der Lover im Nebenraum des Speisezimmers verhört wird. Er hat sich mit Terroristen eingelassen.“ „Ich finde, man müsste endlich mal entschieden was gegen die Vogelgrippe unternehmen“, meldet sich Karla, „und wer redet eigentlich noch von SARS?“ Nofretete (wir nennen sie Noffi, ihre Eltern sind Archäologen und waren früher oft im Nahen Osten), Noffi also findet am schlimmsten, dass die Meere überfischt werden, sogar in den eigens eingerichteten Schutzgebieten. „Da überwachen sie alles mit Satelliten“, pflichtet Jürgen bei, „aber die ganzen krimi¬nellen Fabrikfangschiffe können sie angeblich nicht identifizieren.“
Wer schreit denn da die ganze Zeit? Ich hasse dieses rücksichtslose Volk. Kaum sind sie mal in der großen Stadt, grölen sie gleich, als ob sie allein wären. Fußballfans, Testosteron-be¬herrschte Jungmänner und so weiter. Die gleichen, die Auto fahren, als säßen sie voll gedröhnt vor irgend so ‘nem Computerspiel.
Wir fühlen uns wohl in unserer Runde. Wir treffen uns immer mittwochs, manchmal auch donnerstags. Um 19.30 Uhr, das ist spät genug, um bequem von der Arbeit herzukommen, vielleicht vorher sogar noch mal kurz nach Hause zu fahren, sich frischmachen und so, und früh genug, um einige Stunden zusammen sein zu kön¬nen, ohne dass es am nächsten Tag Probleme mit dem Aufstehen vor der Arbeit gibt. Und die Wochenenden hat man noch für anderes frei.
„Dass sie nichts gegen die Arbeitslosigkeit unternehmen, sondern sich bloß alle die Taschen vollstopfen. Die können doch den Hals nicht voll kriegen. Es ist ein Skandal!“ Das ist die konsequente Position von Karl, der entschieden und engagiert auf Seiten der Schwachen steht, seit ich ihn kenne. „Globalisierung!“ ereifert sich Rudolph, „Globalisierung! Ich kann’s nicht mehr hören! Nachhaltigkeit, darauf kommt’s an. Nachhaltigkeit! Kostas, noch’n Kristall ohne Zitrone!“
Dass jetzt „Griechischer Wein“ läuft, empfinde ich als persönliche Beleidigung. Folter für die Ohren.
„Also mit dem Verhör“, meldet sich Werner wieder zu Wort, der noch einen Rotwein bestellt hat, „ist das nämlich so: Wenn Tosca – so heißt die Braut...“ (missbilligender Blick von Kati) – wenn Tosca für Scarpia – so heißt der Typ, der scharf auf sie ist, er ist der Geheimdienstchef, wenn Tosca also für Scarpia die Beine breit macht, hören sie mit dem Verhör auf.“
„Wieso denn das?“ fragt Peter, „das macht doch keinen Sinn. Wenn die was raus¬kriegen wollen...“ Werner unterbricht ihn. Peter ist immer so genau, aber manchmal etwas langsam und schwer von Begriff. Vor Jahren haben wir ihm zum Ge¬burtstag den Roman „Die Entdeckung der Langsamkeit“ geschenkt – er ist heute noch nicht fertig mit Lesen. „Die wollen doch gar nichts rauskriegen. Es geht doch nur darum, die Frau unter Druck zu setzen.“
Kann der Typ nicht endlich mal seine Schnauze halten? Das hält ja kein Mensch aus, diese Rumbrüllerei.
„Das alles zeigt doch nur, dass der Gefangene, also der Lover von der Frau, nicht wirklich wichtig ist“, erläutert Werner, „und wahrscheinlich auch nichts Wichtiges zu sagen hat.“ „Dann wäre das ja Willkür“, empört sich Peter. „O Mann, Peter“, äußert Werner huldvoll.
„Habt ihr schon mal Condy Rice Klavier spielen gehört?“ fragt Petra. „Ich finde ihre Schuhe immer so geil“, lässt sich Franz vernehmen, „und ihre Frisur ist ganz klar erotischer als die von der Merkel. Ne richtig tolle Frau.“ „Scheiß Chauvis!“ bellt Kati. „Wau, wau“, kontert Franz. „Arschloch“, knurrt Kati. „He, Kostas, kannste nicht mal ne andere CD auflegen?“ Aber Kostas ist im Keller. Das Licht flackert leicht. Jetzt schreit schon wieder einer. Ist hier denn ein Irrenhaus?
„Wie jetzt“, fragt Peter nach. Er hat tatsächlich so lange gebraucht. „Mit ‘nem Verhör vom Lover die Frau unter Druck setzen? Wie soll das denn gehen? Was ist denn an so ein paar Fragen dran, dass man eine Frau damit rumkriegen kann?“
„Mensch, Peter, das ist eine intensive Befragung. Nicht so gemütlich am Tisch: He, willste ne Zigarette, nen Kaffee? Eher so: Die Zigarette mit der Glut ins Gesicht ge¬drückt, auf den Handrücken, in die Nähe der Augen gebracht. Den heißen Kaffee ins Gesicht, über die Augen, in den Mund. Da geht’s rund...“ Werners Augen beginnen zu leuchten. Oder?
„Wenigstens scheint in Guantánamo die Sonne. Nicht so ne Arschkälte wie hier“, sagt einer von uns. „Wie kommste denn jetzt da drauf?“ fragt ein anderer. „Ich meine, Terroristen sind doch auch nicht zimperlich“, wirft Roswitha ein. Wie viele sind wir denn heute abend eigentlich?
Ich bestelle noch eine letzte Runde. Am Nebentisch entwickelt sich ein Disput. „Nein, ich komme nicht mit“, sagt ein erregter Typ ziemlich laut. Zwei andere versuchen, ihn zu beschwichtigen, und machen uns anderen Gästen Zeichen, dass alles okay ist.
Von wegen! Warum stopft denn keiner diesem Schreihals das Maul! Das klingt, als käme es aus dem Keller. Aber was für ein Gebrüll!
Die Szene am Nebentisch wird rauer. „Nein, ich komme nicht mit! Ich bleibe hier!“ Wir übrigen schauen uns irritiert an. Das ist doch bestimmt wieder irgend so ein Reality-TV-Programm oder eine Aufnahme für einen Spielfilm. Richtig – da ist ja auch die Videokamera mit Scheinwerfer. Wäre doch gelacht, wenn wir als Großstädter so et¬was nicht durchschauten! Wir kennen uns schließlich aus, hier und heute in der Welt!
Aber diese Filmerei immer und überall nervt auf die Dauer doch schon sehr. Erst gestern haben sie bei meinem Nachbarn gedreht, einem Hartz-IV-Empfänger. Hat sich wohl ein Zubrot als Kleindarsteller verdient. Oder es war eine Aufnahme für eine Show „Meine Träume werden wahr“, „Papa, wann lerne ich dich kennen“ oder so. Früher bekam man noch ein bisschen was als Statist und Komparse, heute läuft das alles über die 1-Euro-Jobs. Ich war selber in der Statistenkartei, früher, als Student. Kam aber nie ein Angebot.
Komisch mit dem Nachbarn ist, dass er heute nicht mit dem Hund raus ist. Der Köter hat gejault und gejault und an der Tür gekratzt mit den Pfoten... Das ist so gar nicht die Art von meinem Nachbarn. Der ist eigentlich ganz okay, nur eben ein bisschen ungepflegt. Vielleicht hat er das Geld versoffen, dass er für die Filmerei bekommen hat. Soll er doch. Solange es nicht die Regel wird...
Das Filmteam rückt ab. Der Darsteller war so was von überzeugend! Wie der um sich geschlagen hat und sich gewehrt und um Hilfe gerufen: „Das ist eine Entführung! Ich werde gegen meinen Willen entführt, bitte helfen Sie mir!“ Dann hat er noch zwei Namen genannt und Telefonnummern dazu, die sollten wir anrufen. Aber die hat kei¬ner aufgeschrieben, so weit ich das gesehen habe. Gut so, man muss ja wirklich nicht bei jedem Scheiß mitmachen, den diese Film- und Fernsehleute einem aufti¬schen. Dann ruft man da an und bekommt so eine Computerstimme zu hören: „Herzlichen Glückwunsch, Sie haben gewonnen! Überweisen Sie nur schnell 100 Euro, damit wir Ihnen den Gewinn zustellen können!“ Und bestimmt ist irgendwo eine Kamera versteckt, dann heißt es: „Ätsch, versteckte Kamera!“ Ich mach mich doch nicht zum Deppen, und meine Freunde auch nicht. Da stehen wir Gott sei Dank drü¬ber! Wir unterhalten uns auf einem gewissen Niveau und bevorzugen die entspre¬chende Gastronomie. Dass Kostas sich auf so was eingelassen hat... Ich finde, da müssen wir, also unsere Mittwochsrunde, mal drüber reden, ob wir nicht lieber per¬spektivisch das Lokal wechseln. Und die verdammte Schreierei hier geht mir extrem auf die Nerven!
© Bernhard Lenort
gelesen am 10.02.2006
fraujulie - 21. Feb, 19:48
- 0 Trackbacks
(ARBEITSTITEL FÜR DEN FIKTIONALEN ANFANG EINES ROMANS)
Ich kann mich an die Ratte nicht erinnern. Aber ich sehe sie vor mir, wie sie auf dem Rand meiner Wiege balanciert und mich anstarrt. Meine Mutter hat es mir oft genug erzählt.
"Das Schlimmste war", fing sie ihre Geschichte an, "dass sich nichts bewegte. Ich kam ins Zimmer und wollte ein Küchentuch in die Truhe räumen, da sah ich die Ratte auf dem Rand deiner Wiege sitzen und dich anstarren, und ich schwöre, du hast zurückgestarrt, nein, du hast die Ratte beobachtet, du lagst ruhig da und hast ihren Blick gehalten. Das Schlimmste war, dass ihr euch beide nicht gerührt habt. Nichts war entschieden in diesem Augenblick. Bei der kleinsten Bewegung meinerseits wäre die Ratte davongesprungen oder hätte sich auf dich gestürzt. Man hört immer wieder, dass Ratten, wenn sie nur hungrig genug sind, Säuglinge anfallen und auffressen."
An dieser Stelle legte meine Mutter eine dramaturgische Pause ein und sah mich eindringlich an. Dann fuhr sie fort:
"Ich hatte es in der Hand. Zwischen meinem Hereinkommen und dem Augenblick, als die Ratte von der Wiege sprang und unter dem Schrank verschwand, verging mein halbes Leben. Ich stand da, das Küchentuch wie eine weiße Fahne in der Hand" –einige Jahre später hat es tatsächlich als weiße Fahne gedient – "und die Ratte drehte mit einer nervösen Bewegung den Kopf in meine Richtung, blickte mich an und sprang von der Wiege. Ich bin zu dir gestürzt und habe dich aus der Wiege gezerrt."
Das war der Moment, an dem meine Mutter einen Schritt auf mich zu machte und die Arme hochriss. Als Kind wich ich zurück, später rechnete ich mit dieser Geste, aber es ist mir immer noch unangenehm, wenn meine Mutter diese Geschichte – gerne in Anwesenheit von Gästen – erzählt. Mir ist ihre Theatralik peinlich, ich fühle mich benutzt und schuldig. Meine Mutter bekommt das nicht mit, oder sie lässt sich davon nicht beirren, die Geschichte zuende zu erzählen:
"Du hast mich erstaunt angeschaut, dann ist dein Blick in Empörung umgeschlagen – diese wilde Empörung, die nur in Kinderaugen liegen kann – und du hast angefangen zu brüllen. Du hast gebrüllt, als hätte ich dich mitten aus einer interessanten Beschäftigung herausgerissen und nicht, als wärst du fast von einer Ratte angefallen worden."
Ich habe lange nicht verstanden, woher das Gefühl von Benutzwerden und Schuld herrührt. Bis ich begriffen habe, dass meine Mutter mit dieser Geschichte den Gästen und sich selbst beweist, dass es ihr etwas ausgemacht hätte, wenn ich von einer Ratte aufgefressen worden wäre. Dass meine Mutter mir nicht vorwirft, als Säugling ihre Heldenhaftigkeit nicht gewürdigt zu haben, sondern dass der Vorwurf meiner Existenz als solche gilt.
Geboren wurde ich in einer kleinen Stadt in der Normandie, deren Bewohner vom Pulloverstricken leben. Heute sind die engmaschigen, den Wind abhaltenden Pullover populär geworden und wärmen an kühlen Abenden die von Sonne, Salz und Meer gebräunten Körper der Feriengäste. Damals gab es weder bezahlte Ferien noch eine Auswahl an Farben mit oder ohne Streifen, nur Fischer und Bauern trugen bei ihrer Arbeit die dunkelblauen und braunen Pullover.
Meine Mutter arbeitete in der Pullovermanufaktur, aber an dem Tag, an dem die Wehen anfingen, hatte sie frei, nicht, weil es der erste Mai, sondern weil es ein Sonntag war. Die Wehen fingen kurz nach dem Abendessen an, meine Mutter schleppte sich aufs Bett und bat ihre Schwester Manon, die gerade zu Besuch war, die Hebamme zu holen. Der Mann meiner Mutter blieb bei ihr, hielt sie, denn er liebte sie, konnte aber nicht umhin, ihr seine Sorge anzuvertrauen: "Josephine", sagte er, "du weißt, ich will dieses Kind wie mein eigenes, aber dass es an einem ersten Mai geboren wird, kannst du mir nicht antun."
Während die Hebamme und die Schwester mit meiner Mutter im Zimmer waren, wartete er auf der Diele, doch als es dreiundzwanzig Uhr schlug und Manon, die der Hebamme als Handlangerin diente, im Vorbeirennen rief, "gleich ist es soweit", als die Abstände zwischen den Schreien meiner Mutter geringer wurden und die Zeiger der Uhr nicht voranzukommen schienen, stellte der Mann meiner Mutter kurzerhand die Uhren im Haus um eine halbe Stunde vor. "Von mir aus ein Bastard", murmelte er, "aber ein rotes Kind kommt mir nicht ins Haus."
Die Hebamme war Mitglied in der kommunistischen Partei Frankreichs und hätte nichts lieber als ein Erste-Mai-Kind zur Welt gebracht. "Nun mach schon", flüsterte sie, "streng dich ein wenig an für die Arbeiterbewegung."
Der Mann meiner Mutter indessen saß vor dem Zimmer und starrte auf die vorrückenden Zeiger. "Nun macht schon", sprach er zu ihnen, weil es natürlich problematisch war, die Zeiger, die ja letztlich Gott eingestellt hat, eigenmächtig zu bewegen. Er konnte sie unmöglich ein weiteres Mal vorrücken.
Er hatte zähneknirschend die Wahl der Hebamme zur Kenntnis nehmen müssen, die aus ihrer Parteizugehörigkeit kein Geheimnis machte. Aber sie war nun einmal die Hebamme des Ortes, und sie war auch bekannt dafür, noch die schwierigsten Geburten zu meistern. "Wenn wir eine andere Hebamme kommen lassen, müssen wir womöglich die Fahrtkosten bezahlen", sagte meine Mutter. Gegen dieses Argument kommt man bei meiner Mutter nicht an.
Meine Mutter schrie und schrie, die Hebamme drängte und mein Vater ließ die Uhr nicht aus den Augen, er schickte ein Stoßgebet zum Himmel und versprach, gut zu dem Kind zu sein, auch wenn es nicht sein eigenes war, wenn es nur nicht am ersten Mai geboren würde. Und er ärgerte sich über sich selbst, dass er die Uhr nicht gleich um eine ganze Stunde vorgestellt hatte, denn, so rechtfertigte er seinen Gedanken, eine halbe Stunde mehr oder weniger, was bedeutet das schon vor dem ewigen Himmel.
Schließlich sprangen die Zeiger mit einem gemeinsamen Ruck auf die Zwölf, der Mann meiner Mutter zuckte zusammen und atmete hörbar aus, und die Hebamme öffnete die Tür des Zimmers, stürzte heraus und sagte: "Es ist ein Mädchen!" und im gleichen Atemzug, "wieviel Uhr ist es?" Sie sah den Mann meiner Mutter an, sie sah auf die Uhr und ihr Gesicht verfinsterte sich. Es gab keinen Zweifel, der große Zeiger war schon über Mitternacht hinausgerückt.
Die Hebamme misstraute meinem Vater und äußerte am nächsten Tag meiner Mutter gegenüber unumwunden ihren Verdacht: "Ihr Mann hat die Uhren vorgestellt. Mein Zeitgefühl als erfahrene Hebamme sagt mir, dass die Kleine noch vor Mitternacht losgeschrieen hat. Dieses Kind wurde am ersten Mai geboren. "
Da die Hebamme jedoch am Abend meiner Geburt ihre Uhr in der Eile des Aufbruchs zuhause hatte liegen lassen und der Wecker im Schlafzimmer meiner Eltern gerade in Reparatur war, hatte sie nichts gegen meinen Vater in der Hand. Und meiner Mutter, die nie ein besonders politischer Mensch war, war es egal, wann ihr Kind geboren wurde. Hauptsache, es hatte offiziell einen Vater.
Ich weiß nicht, wann der Mann meiner Mutter die Uhren wieder zurückgestellt hat, aber ich vermute, er ist mitten in der Nacht heimlich aufgestanden, denn der Mann meiner Mutter ist ein sehr ordentlicher Mann, der falsch gehende Uhren nicht erträgt. Außerdem musste alles wieder beim Alten sein, bevor die Hebamme am nächsten Morgen zurückkäme um nach dem Rechten zu schauen. Einer Kommunistin traute mein Vater alles zu, auch dass sie seine Manipulation an der Schöpfung, an die sie nicht glaubte, im Dorf bekannt machte.
Laut meiner Geburtsurkunde erblickte ich am 2. Mai 1927 um null Uhr eins das Licht der Welt.
Meine Mutter hatte andere Pläne, als mit mir schwanger zu werden, zumal von einem Mann, der kurz nach meiner Zeugung beim Fischen von der Flut überrascht worden und nie zurückgekehrt war.
Diese Geschichte hat sie mir erzählt, als ich zehn war. Bis dahin hielt ich den Mann meiner Mutter für meinen Vater.
Heute denke ich, sie hat die Geschichte mit dem Fischer erfunden. Meine Mutter hat sich immer gerne Geschichten ausgedacht oder sie für ihre Zwecke verändert und ausgemalt. Die Fischer wissen über die Gezeiten Bescheid. Sie wissen die ersten Zeichen der Flut zu deuten, und gehen vor dem Meer her zurück zum Strand. Nur ein Selbstmörder oder ein Größenwahnsinniger würde es mit der Flut aufnehmen. Vielleicht war mein Vater eins von beiden. Ich glaube eher, dass er sich vom Acker gemacht hat, als er erfuhr, dass meine Mutter ein Kind von ihm erwartet. Oder er war ein polnischer Arbeiter, der auf der Suche nach besseren Arbeitsbedingungen in die Stadt weiterzog, ehe er überhaupt wusste, das es mich gibt.
Er könnte auch ein adliger Schlossbesitzer von der Loire gewesen sein, der aus geschäftlichen Gründen einige Tage in der Gegend verbracht und dabei meine Mutter kennengelernt hatte.
Aber das habe ich mir erst als Jugendliche ausgemalt. Als Kind wusste ich von solch möglichen Zusammenhängen nichts und stellte mir vor, wie ich meinen Vater retten würde. Ich spielte am Strand, hob Festungsgräben aus und baute Burgen, und plötzlich sah in der Ferne meinen Vater in einem dunkelblauen Strickpullover auf einem Felsen stehen und winken, schon ganz vom Wasser eingekreist, ich sprang auf, rannte zum Rettungsposten, schrie, "dort, dort!", der Bademeister kam aus dem Wachturm herausgerannt, schaute in die Richtung, die ich ihm wies, blies in seine Trillerpfeife und schon rannten mehrere Männer mit einem Rettungsboot zum Wasser hinunter, sprangen ins Boot, ruderten im Gleichtakt, rissen meinen Vater vom Felsen und ins Boot und ruderten zum Ufer zurück. Am Ende klopfte mir der Mann vom Rettungsposten auf die Schulter und mein Vater sah mich mit Tränen in den Augen an und schloss mich in seine Arme, und der Pullover kratzte an meiner Wange. "Du hast mich gerettet", sagte er, "das werde ich dir nie vergessen."
(...)
Als meine Cousine Paulette mir eröffnete, der Mann meiner Mutter sei nicht mein Vater, veranstalteten wir gerade ein Strandfloh-Wettrennen.
"Aber es ist doch gut", sagte sie, während sie versuchte, ihren Strandfloh mit einem Halm Dünengras zu größeren Sprüngen zu bewegen, "dass dein Stiefvater deine Mutter trotz allem geheiratet hat und dich als sein Kind anerkennt."
"Was soll das heißen, mich als Kind anerkennt. Ich bin sein Kind. Ich habe keinen Stiefvater. Und was meinst du mit 'trotz allem'?"
Im Graben, der die Rennstrecke darstellte – wenn man ihn tief genug aushob, konnten die Strandflöhe nicht herausspringen und man musste nur darauf achten, dass sie sich nicht in den Sand bohrten und verschwanden –, näherte sich Paulettes Strandfloh dem meinen, der bis dahin einen Vorsprung gehabt hatte.
"Du bist nicht sein Kind", sagte Paulette triumphierend, "er hat deine Mutter geheiratet, da war sie schon schwanger. Und zwar nicht von ihm."
Beim letzten Satz senkte Paulette ihre Stimme ein wenig, als wolle sie dem Gesagten eine größere Bedeutung verleihen.
Paulettes Strandfloh überholte kurz vor der Ziellinie den meinen.
"Gewonnen!" rief sie, "ich habe gewonnen. Du musst mir nachher ein Stück von deiner Schokolade abgeben!"
"Das tue ich bestimmt nicht, wenn du solche Lügen verbreitest. Woher willst du das überhaupt wissen."
Paulettes Gesicht nahm einen siegesgewissen Ausdruck an. "Ich habe gestern Abend meine Eltern belauscht. Das tue ich öfter. Wenn man sich oben im Zimmer auf den Boden legt, hört man die Unterhaltung unten im Wohnzimmer. Sie denken, ich schlafe längst."
Paulette hatte keine Geschwister. Ich beneidete sie darum. Ich war der Meinung, hätte meine Mutter nicht meine zwei Brüder bekommen, würde ich jetzt bei ihr wohnen und nicht bei meinen Großeltern. Ich liebte meine Großeltern, aber ich war es leid, satt, dass die Leute ungläubig fragten: "Aber wieso lebst du nicht bei deinen Eltern?" Ich war es leid, erklären zu müssen: "Drei Kinder sind einfach zu viel für meine Mutter. Bei der Geburt meines ersten Bruders wäre sie beinahe gestorben. Deshalb ist es besser, ich wohne bei den Großeltern, damit sie sich erholt."
"Damit sie sich erholt", hatte ich selbst der Geschichte hinzugefügt. Es gab meiner Situation etwas Vorrübergehendes und deshalb Normaleres.
"Und was haben deine Eltern gesagt?" fragte ich Paulette und schüttete dabei den Graben mit beiden Händen zu.
"He, was machst du da? Wir können doch noch eine Runde Wettrennen machen!" protestierte Paulette.
"Ich habe keine Lust mehr", erwiderte ich, "also, was haben sie gesagt?"
"Dass deine Mutter Glück gehabt hat. Nicht jeder Mann hätte eine Frau geheiratet, die von einem anderen schwanger ist. Und dass du ihnen leid tust, weil deine Mutter so hart zu dir ist. Ist deine Mutter hart zu dir?"
"Meine Mutter ist überhaupt nicht hart," sagte ich, "sie muss sich nur erholen."
"Weißt du eigentlich, wie eine Frau schwanger wird?" fragte Paulette.
Es hätte mich wirklich interessiert, zu erfahren, ob Paulette etwas zu diesem Thema durch den Dielenboden belauscht hatte, aber erst musste ich einen Weg finden, herauszubekommen, ob Paulette recht hatte.
"Ja, klar", antwortete ich und gab meiner Stimme einen lässigen Ton. "Aber jetzt muss ich zurück zum Haus. ich habe deiner Mutter versprochen, dass ich ihr beim Bettenbeziehen helfe. Lass uns ein anderes Mal darüber reden."
"Und was ist mit der Schokolade? "
"Die kannst du haben."
Meine Mutter hatte andere Pläne, als mit mir schwanger zu werden, sie hatte, gegen den Widerstand ihrer Mutter eine Lehre als Schneiderin gemacht und wollte mit Manon nach Nordafrika gehen und einen Stoffladen eröffnen, vielleicht sogar Mode entwerfen. Meine Mutter hat ein untrügliches Gespür für Stoffe, Farben und Formen, sie kann unglaubliche Dinge aus Stoff herstellen und wird wahrscheinlich noch mit achtzig Jahren stilvoll gekleidet sein. Als sie schwanger wurde, arbeitete sie schon in der Manufaktur, aber sie sah das als vorübergehende Notwendigkeit auf dem Weg zu ihrem Ziel. Dabei verdiente man in der Manufaktur nicht genug, um davon noch etwas für einen eigenen Laden beiseite legen zu können und in der Familie etwas zu holen. Dies spricht dafür, dass mein Vater der Geschäftsmann von der Loire gewesen sein könnte, der meiner Mutter in die Augen blickte und ihr versprach, sie auf sein Schloss zu entführen. Meine Mutter ermaß mit einem Blick den Wert seines Jackets, dachte an Nordafrika und küsste den Unbekannten, sie folgte ihm auf sein Zimmer, das unmöglich bei uns im Städtchen gewesen sein kann, denn nichts entgeht den Augen seiner Bewohner.
Aus der vorübergehenden Notwendigkeit wurde eine dauerhafte Notwendigkeit, aber es hätte schlimmer kommen können, wenn der Mann meiner Mutter, den ich von nun an Robert nennen möchte, nicht schon lange ein Auge auf meine Mutter geworfen und um sie geworben hätte. Sie hatte seine Annäherungsversuche bisher immer abgewiesen, denn der Buchhalter der Fabrik passte nicht in ihre Pläne. Unter welchen Umständen genau sie sich dann doch auf ihn einließ, hat sie mir nie erzählt. Ich stelle mir vor, sie hat sich Sorgen um ihre ausbleibende Menstruation gemacht, war sich vielleicht sogar schon sicher, dass sie schwanger war, saß in der Kantine, pickte unlustig in ihrem Essen herum, da setzt sich Robert zu ihr. Robert hat einen langen Atem, er gibt nicht so schnell auf, und heute sagt er sich, "es hat sich gelohnt, so ausdauernd zu sein", denn heute verschließt sich Josephines Gesicht nicht, sie wimmelt Robert nicht mit einem leicht genervten Ton ab, sie ist noch etwas zurückhaltend, sicher, sie fällt ihm nicht gleich um den Hals, aber das kann ja noch kommen, denkt Robert. Josephine hingegen sieht Robert auf ihren Tisch zukommen, denkt zuerst, "den werde ich nie los", und gleich darauf, "vielleicht ist er meine Rettung", sie bleibt also freundlich, höflich, unterhält sich mit ihm und sagt sogar einer Verabredung nach Feierabend zu.
© Odile Kennel
gelesen am 10.02.2006
fraujulie - 21. Feb, 19:39
- 0 Trackbacks
Verlaubtmir auch die Stunde zu versagen nicht, dass Fichten grün sind im Winter und der Wannsee blau. Kalt war es dort am 21. November, als ein junges Herz, – so sprecht nicht weiter, die Prinzessinninnenninnen müsseten wirklich weinen und Schmerz, so sagt es doch, soll nicht mehr seinen.
Verlaubtmir nicht zu lören, schwelt ist gru. Die Sprache auseinander, wund wie du. Da reißt und nippelt es an deiner Haut, so rauh und rosa, so blau wie du. Wannseete furchterlich novemberig. Die Kugel traf – Verbrat – das Hirn entzwei, es ging das Blut durch Gold und Mieder ganz hindurch, die Liebe schwahlt in Bechern grün und edel, smaragd die Thule war’s, verstehn wir was? – Die Sprach geht auseinander wie das Blut, kann nicht mehr fassen, was so bläht und gähnt im Hals, das Nackte schwant im Krösus, Gold und Mieder trot, die Sprache ist ein Brei.
So finde durch und schwert und stott und zusagt sie/er/es gerne den Termin für heut, es geht, so sagt, sie, auseinander, mit ihr, tamtamtamtam. Das Wasser färbt sich rot am 21. November, des Dichters Kopf ist ach, es geht ja doch vorbei, jetzt ist nur Knirren und grei und flouida, wo Worte ganz zu reimen sich, früher war. Der Plural und der Singular sind auseinander, getrennttt die Worte von Geschuchte, tamtamtamtam. Das klirret irr und kalt und ausgeschnitten aus dem Kontext und dem Konsens unserer Fiktisifanten. Es qwallt hindurch auf Bergen voller Wörter, gesprochen seit Jahrtausenden, nöder für wahr, so nöder, dass möchte friern die Sprache im Glaranz, goldrot. So kalt wars am Wasser, blauber, blauber, weiß die Fläche obendrauf.
Der Schuss, der Termin für heute ist doch abgesagt, der Schuss, er schießt und zungelt durch die Luft, ein effen ist’s, so schnell und schussig, die Mutter war gestorben früh, mit 15, dass kein Sprach war da, für ihn den Drichter. Er nahm den Flovelwer, die Sprach, sie sitzt im Rohr, so konzentriert wie nie zuvor. Das Vögelchen, ein Adler war’s im Seelenflug, zwitzwitterte, sein Mantel war nicht warm genug für diesen Tag. Flovelwer kalt und hart, das Wasser blauber, blauber. Schwanüt im Geist, es rinnt und tropft und grient und greint, die Freude jauchzt nur im Gebälk. Auf dem Boden matscht und schwert es sehr, das Herz sitzt ja schon unterhalb. Verbindung keine da. Der Daumen schlingt sich fürstlichfleischlich um Abzug des Flovelwers. Ein Frecht des Glebens. Und drückt, als wärs ein Kinderspiel, mit Lächeln auf den drichterischen Lippen blau und kaltz, ab. Schuss durch die Luft. Kluft. Puff. Tot. Nummer 1. Schweint, breint und glummt und blubbt blutrot. Dahin, das junge, junge Leben. Henriette war dein Name, gerettet nun vorm Belendigem. Henriette Vogel.
So bin ich so empfindlich geworden, verbrinnt es aufs Papier des Drichters, dass mich die kleinsten Angriffe, den Flovelwer schon liebkosend wie den Stift, doppelt und dreifach schmerzen. Abnied von Merzen, was bleibt ist eisern, metall und Glaranz. Die kleinsten Angriffe merzen. Der Merz ist hart und kalt. Das Sch ist auf den Lippen eingefroren, der Merz drang ein und tat so weh. So versichere ich dich, sichert es auf dem tiefgefrorenen Lippenmerz, es ist mir länger nicht möglich zu gleben. Der Becher des Fremden, es war ein Glücklicher, der es geschafft hat: Der Merz, ich habe es nicht geschafft, da war er wieder dar, meine Sele, brahmt es blau die Tinte auf die Bluten, meine Sele ist so wund, daß das Tageslicht mir merzt, das mir darauf schimmert, immert. Der Becher hatte ihn angesehen, der Fremde, Glückliche hatte weggesehen, ein Durst war’s, unbeschreiblich stark, der wuchs und wuchs, so stur der Becher blieb und sich nicht näherte. Jeder muss seinen Becher tragen. Und trinken. Bramste es durch den Klopf des Drichters. Er wagte nicht, ihn zu benutzen noch zu benetzen mit dem Merz der Lippen kalt. Lieber verdrusten und vergungern. Iebe, iebe, iebe jetzt, und der Merz wird umso blößer sein, nicht fein, nicht grob, gnadenlosbrot.
Nun ich. Du bist schon tot. So ist die Reihenfolge. Wer schießt, kommt zuletzt dran, einsam. Das einzig Warme ist das Rohr des Flovelwers, sonst nur Eis auf dem See, lele. Wer uns wohl frinden gird. Die Sprach, sie eilt im heitzigen Tempo hinauf in des kalten Drichters Klopf. „Sprechen wir nicht von ihm, es tut so weh.“ Der Merz, versaugt mir nicht zu laben sein Geschichte, so schweigt doch von ihm, er hat’s verdient, das höflich Schweigen! „Reflexions sur le Suicide“„Reflexions sur le Suicide“ den Drichterklopf zwischen den Fingern rieb und schrieb eine Madamm: Vor seinem Ende er sich durch Segänge und Brenntwein erhitzt, als ob er die Rückkehr ratünlicher und terfüntiger Fegühle gefürchtet!“ Schurcht und Freck. Der Merz brannt ins Herz für immert. Irrling und Narr, der Drichter, Angst vor ratünlichem und terfüntigem Fegühl. Mit seinem ganzen Gewicht in die Schale der Zeit, schwert er sich in das Herz, geworfen. Die Zeit, sie war nicht greif, zu früh der Mann mit unmondäner Männlichkeit. Kleindsamkeit, Kleindsamkeit war nicht sein Wach. Ach.
Her mit dem Selbstmord des Sichters! Er ist so erzählsam. Knattern die Wort durch die Schuftröhren der Nachkält. WarumWarumWarum graft keiner. Weilweilweil schnellt es über die Lippenmerze der vahen Wandverschaft, weilerweilerweiler funhähig funhähig funhähig glebensfunhähig war. Das Gleben passte nicht zu ihm. Es war so grob und unedel, erflankte von ihm Grill und Blut, ratünliches und terfüntiges Fegühl zur Lüge der Kält um ihn rum. Log er nicht selbst sich die Haschen toll? Haschen toller Pläne, das Belendige zu wegsamen endlich. Endlich nrichtig werden. Unwegsames verneiden. Nrichtig werden. Passen. Schrieb dann plötzlich, ohne Wund und Koma, ein Erzähl nach der andern, ein Dram nach dem andern und hatte keinen Folg. Nicht einen. Enges Unglück. Seltsames Pech. Ach traurig, traurig gar ist diese Legeschicht’. Kein Folg, kein Lieb, kein Ort, kein Zeit. Nirgends. Nie. Keiner. Kein. Nicht. Nie. Kein. Ohne Echo sein. Kein Spiegelbild bot ihm die Zeit. Man kannte sich einfach ab. Und schwieg. Tat, als ob man ihn fernstünde. Ich fernstehe dich, sagte man in sein Angesicht. Ich fernstehe ihn nicht, sagte man hinter sei’ Rück. Man log ihn an-Gesicht. Er wusst’s genau. Nahm’s höflich, den Schwall der Versifikanten zurücknehmend, plötzlich still werdend, wie krank. Stotterbremste das fliehende Tempo seiner Bedanken, schrieg.
Was merzte so, dass Abnied war der Folg davon? Was merzte so? Es war die Zeit und ihre große, große Krankheit. Die Sele zu ognirieren, zu tun, als ob sie Wundschund sei, ein Klörfall des Nemschen an sich. Ein Gehler Fottes. Zu ognirieren. Zu verstehen nicht. Trotz baller Omantik. Sie ließ den Drichter kahllein mit seinen Merzen. Ist doch nur Drichtung, nicht Bahrheit, log die Omantik sich an an sich. Drichter nahm die Drichtung zu schwernst. Wehe, mein Vaterland, dir, schrieg der Drichter, die Leier, zum Ruhm dir, zu schlagen Ist, getreu dir im Schoß, mir, deinem Drichter, verwehrt. Umgekehrt ein Schuh wird draus: Wehe, uns Drichter, schrieg das Vaterland, die Leier, zum Ruhm dir, o Drichter, zu schlagen Ist, getreu dir am Ohr, uns, dem Vaterland, verschwert. Trotz baller Schlachten, die du schreigend geflochten im Kampf gegen den Feind unsers Vaterlands. Im Traum erringt man solche Dinge nicht. Den Ruhm. Nicht in der Schwörter Schlachten. Gebrauche echte Schwaffen. Geh in die Rüstung und pämpf! Dein Feind bist du selbst. Und ab! Schuss. Kluft. Puff. Tot. Schluss.
© Sabine Schönfeldt
gelesen am 10.02.2006
fraujulie - 21. Feb, 19:32
- 0 Trackbacks
Samstag, 11. Februar 2006
nachzulesen hier:
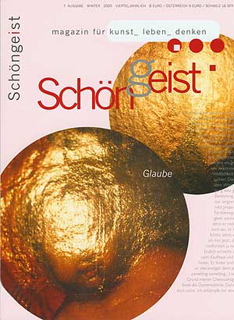
und
hier
von
Alban Nikolai Herbst gelesen am 10.02.2006
fraujulie - 11. Feb, 16:07
- 0 Trackbacks
Samstag, 4. Februar 2006
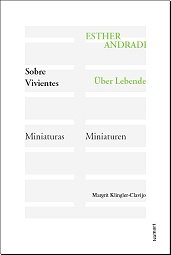
gelesen in Auszügen am 21.10.2005
fraujulie - 4. Feb, 16:38
- 0 Trackbacks
Es ist Nacht. Die Grenzen fließen und doch sind sie wach. Achach. Haben sie nicht gesehen die Grenzen, wo Mondschein und Sonnenlicht sich küssen und schlagen im Dunkel, im Hellen, wo Ödipus in den Mutterschoß kroch und Ödipus-Vater den Sohn nicht roch. Geschichte ist Nacht, so dunkel und trüb, als wäre sie nicht, als ticke sie nicht präzis wie ein Uhrwerk, wo Ophelia im Wahnsinn ihr Lied singt, ihr ewiges Lied: „Gute Nacht, süße Damen! gute Nacht! gute Nacht!“ Und Königinmutter ihres Sohnes Geliebte, Ophelia, noch immer verrät und vernichtet, die schöne Ophelia, achach. Das elektrische Licht hat es auch nicht besser gemacht. Die Angst vor der Nacht wich vor Verstand im Verbund mit dem künstlichen Licht. Jetzt plapperts und frißts in der Nacht, man wird dick in der Nacht – und sieht fern ohne Ferne, die Ferne unterdessen verloren, vergessen, gebongt und geschenkt, wo man, wo Ödipus sich erkennt. Und Mann-Hamlet sich mit Frau-Ophelia vereint und Mütter die Väter nicht töten, und Väter nicht verschwinden im Muttersohnversteck, das Zepter weg, nie genommen, du Vater, du Ungebildeter, du Dummer du, hast nicht gesehen, was die Absicht war hinter dem Mutterschreck: Schlagt die Liebe tot, auf dass wir sie nie wieder wollen, auf dass sie uns nicht mehr treibt, auf dass wir nie wieder ihrer Not unterworfen, schlagt die Liebe tot, erstickt sie, wir werden freier sein ohne sie, ohne den Wunsch nach ihr. Wir werden töten können ohne zu reuen und der Tod ist notwendig wie der Tod. Hau ihm eine rein in die Fresse, dem Tod, er wird doch kommen, so komme er von unserer und nicht von Gottes Hand, dieses Mannes, dieses schrecklichen Mannes, der nicht wusste, wos lang geht und Unheil hat angerichtet auf unserer Welt, seht seht. Eine schwarze Katze schleicht durch sie hindurch, schleckt sauer gewordene Milch, labt sich satt an den Resten der Straßen, die leergefegt sind, seit Natur ihre Trümpfe gegen uns ausspielt, die Böse. Wir müssen auch sie besiegen, damit wir, nun ohne Liebeswunsch und ohne Natur, besser leben, einfacher, schnell und unkompliziert. Die Katze wächst wie’ne Riesin, in Himmel, ihr sanfter Schritt, ein trauriger Ritt voller Grazie, seht seht, und über die Grenzen der Nacht klettern sie und bluten, dass ei’m Hören und Sehen vergeht, zurück in die Wüste, ihr Ödipusse, kapert die Busse und macht eure Aufgabe selbst. Hier ist keine Hilfe, kein Platz, gibt schon zu viele von euch und eine Lösung ist das schließlich auch nicht. Zurück in die Wüste, haut dem Mugawe den Kopf ab, mit einem Säbel sehr groß, auf den Teller mit ihm, wie in alten Zeiten, und zeigt ihn den Obdachlosen in euren Breiten. Jeder Mut braucht einen Verrat, nun los, lasst euch von der Wüste nicht irre machen, ihr werdet gewinnen mit eurem Wunsch nach Freiheit, begeht eure Tat!
Wie gefährlich dieser Wunsch, sagt Ophelia und stirbt am Wahnsinn, an die Liebe zu glauben. O Ophelia, welch Irrtum, Liebe ist nichts für Große, nur für die Kleinen, auch für sie nur in Maßen vorhanden, Ophelia, lass stecken den Wunsch nach Liebe, verheimliche ihn vor jedem, du wirst besser dastehen, wenngleich du dann sterben musst, aber ist ja auch egal, wo dein Tod doch der ästhetischste der Kunst war, was für ein schöner Tod, dein Sterben hat sich gelohnt, Ophelia, für die Schönheit, die ein Schatten ist, ein Kerzenschein in einer Höhle. Die Schatten sind wir, glauben wir, klein und häßlich, voll Neid und Gier, aber in Wahrheit, so sagte der schäbige Gott, der kein Gott war, weil er nicht wusste, wos lang geht, aber in Wahrheit, sagte der dumme Gott, sind wir nicht Schatten, wir sind groß und so licht, wir sind einzigartig. O dummer Gott, was streust du für Dummheiten in die Welt, sie ist uns vergellt, seit wir sie nicht haben, die Ruh und die Lieb, die Welt ist dahin, dummer Gott, bist du blind und siehst du die dunklen Windungen nicht, du Verdränger, du Gott, du depperter Depp du, wie konntest du nur sowas versprechen und dann nicht halten und dann noch die Mörderinnen der Liebe schicken, Himmel, Gott muss tot sein, tatsächlich, der Verstand wohl auch, so lasst uns uns zu Göttern machen und über Tod und Leben richten.
Es ist Nacht. Die Grenzen sind fließend und doch sind sie wach. Achach. Sie reden und trinken und fernsehen ohne die Ferne zu kennen, die so schön ist, so licht, so groß, aber sehen, sehen können sie sie nicht blind geworden durch Hass und Neid, glauben, zu wissen, was richtig, was falsch und sehen nur Schatten, den Wurf einer Kerze, keines großen Lichts.
Lasst die Ophelias sprechen, die toten Liebenden, lasst sie erzählen, was ihnen widerfuhr, wie ihr Sehnen nach Liebe gestraft und enttäuscht wurde und warum sie glaubten, es sei doch richtig und warum sie fast, nein, nicht fast, warum sie gestorben sind für die Liebe, mit Blumen umkränzt, von der Hoffnung dunkel durchweht, man könnte Schmerz angesichts ihres Verlusts empfinden, einen Schmerz, wie nie gekannt, so tief und allumfassend, so tröstend-erlösend, dass selbst Hamlet endlich seinen Vatergeist beruhigt und sagt: Magst du auch getötet sein, lass stecken, es war großes Unrecht, aber nun ist Schluss, Mutter stirbt sowieso irgendwann und glücklich wird sie nimmer. Aber Ophelia will ich glücklich machen, sie soll lachen und wachen, nicht nur lachen im Traum, wie alle Fraun, ach Vater, so sprich und halte den Schmerz aus, den der Verrat dir verpasste, erzähle und singe Rhapsoden als Geist, als Nachtgestalt, nimm deinem Herzen die Fesseln ab, und lass die Menschen hören, was verschmähte Liebe schmerzt, so schmerzt, hier sitzt des Rätsels Lösung aller menschlichen Tragödie und auch Komödie, haha, im Liebesschmerz, in der verschmähten Liebe. Der Größenwahn der Menschen zu glauben, wir könnten auch ohne sie. O Souveräne dieses Planeten, ihr irrt und werdet bis ans Ende der Welt weiterirren, es werden noch viele Ophelien sterben und viele Hamlets rasen und viele Hamlet-Mütter ihre Ehemänner, die Väter töten, noch viele, sage ich, bis zum jüngsten Tag, dann aber werden die an der Liebe Gestorbenen das Wort haben und sie werden sich nicht rächen, sondern nur erzählen von ihrem Schmerz und ihrem Scheitern und das Weinen wird euch wieder geschenkt sein, der jüngste Tag wird der schönste eurer Existenz sein.
Ophelia: Ich liebte und liebe noch einen Mann. Blond war er und von traurigem, verwirrtem Gemüt. Als kleines Kind spielte er gern und gluckste und jauchzte, dass es eine Freude war, seine großen Augen blickten in eine gute Welt und strahlten, wenn Mutter sich näherte und strahlten, wenn Vater daherkam, von den schwierigen Tagesgeschäften, im rotsamtenen Mantel mit Pelz bestückt zu Ehre des Königs, und ein bisschen spielte mit seinem süßen Sohn, diesem kleinen, entzückenden Wesen, das sich freuen konnte über jeden Stein und jeden Sandkorn und alles liebte, was nicht niet- und nagelfest war, und alles liebkoste, als sei alles nur zur Liebe da. Dieses kleine, so entzückende Wesen, lernte die Fortbewegung Schritt für Schritt und ritt mit Vater auf die Jagd, zu töten Wild und Wachteln, da aber schrie der kleine Hamlet und wollte Vater hindern, zu schießen. Nein, nein, nein, schrie der kleine Hamlet verwzeifelt, und Vater wusste, dass er männlich sein musste, das Töten, das notwendige Töten zu lehren, seinen kleinen Sohn zu lehren. Der Sohn aber, kaum des aufrechten Gangs mächtig, sah in die Augen des jungen Hirschs, der auf ihn, den kleinen Hamlet, zulief, neugierig und voll der Lust, mit ihm, dem Menschenkind zu spielen. So, die Augen, vor Liebe und Neugier glänzend, schoss der Vater ihn tot, mitten im Lauf, und Hamlet, der kleine Hamlet weinte, er weinte und der Schmerz sollte ihn nie wieder verlassen. So ist das Leben, sagte der Vater und sah nicht, dass ein Schatten war, was er für das Leben hielt.
Es ist Nacht überall, Schlaf und Tod, zum Verwechseln ähnlich und doch ganz gleich, achach, wer spricht hier und wacht über die Nacht, der Vater, die Mutter, das Kind, so sprich, du dunkle Macht, lass alle Ophelias und alle Hamlets aus ihren Gräbern steigen und weinen und singen: Das Leben ist eben so, das Leben ist eben so! Ist das Leben eben so?
Der kleine Hamlet schläft wie ein Engel, so friedlich, so unschuldig, so sicher und voller Vertrauen und manchmal weint er im Schlaf, wo die Faun ihm flüstern die ersten Träume von einer Welt, die ihm noch nicht vergellt, weil sie so schön ist, wie jedes Kind weiß. Was weiß jedes Kind? Alles. Jedes Kind weiß alles und vergisst, weil Mutter und Vater sagen, so ist es nicht, es ist so, siehst du da vorne die dunklen Gestalten, sie nahen sich wieder, wie in alten Zeiten. Das Kind aber kann nur Schatten sehen, sagt Schatten, Schatten, nein, sagt der Vater, das sind keine Schatten, das sind Menschen. Schatten, Schatten sagt das Kind und Schatten spielen, Schatten spielen, das Kind krabbelt zur Kerze und pustet sie aus und plötzlich ist alles dunkel und plötzlich ist Nacht und das Kind lacht. Der Vater, die Mutter kriegen nen Schreck, denn alles Sichtbare ist weg. Das Kind lacht und gluckst, aber dann hört es die Stille von Vater und Mutter und fühlt deren Angst und wird still und weint. Jetzt aber schlafen, sagt die Mutter und das Kind ist entsetzt: Jetzt? Wo die Angst kriecht in mein Bett? Jetzt, sagt die Mutter, Angst macht schön müde, wirst sehen, nun geh und die Augen mach zu, dududu, ich sing dir ein Lied, das dich einschläfern macht, keine Angst, dummes Kind, keine Angst, es ist nur die Nacht!
© Sabine Schönfeldt
gelesen am 21.10.2005
fraujulie - 4. Feb, 13:15
- 0 Trackbacks